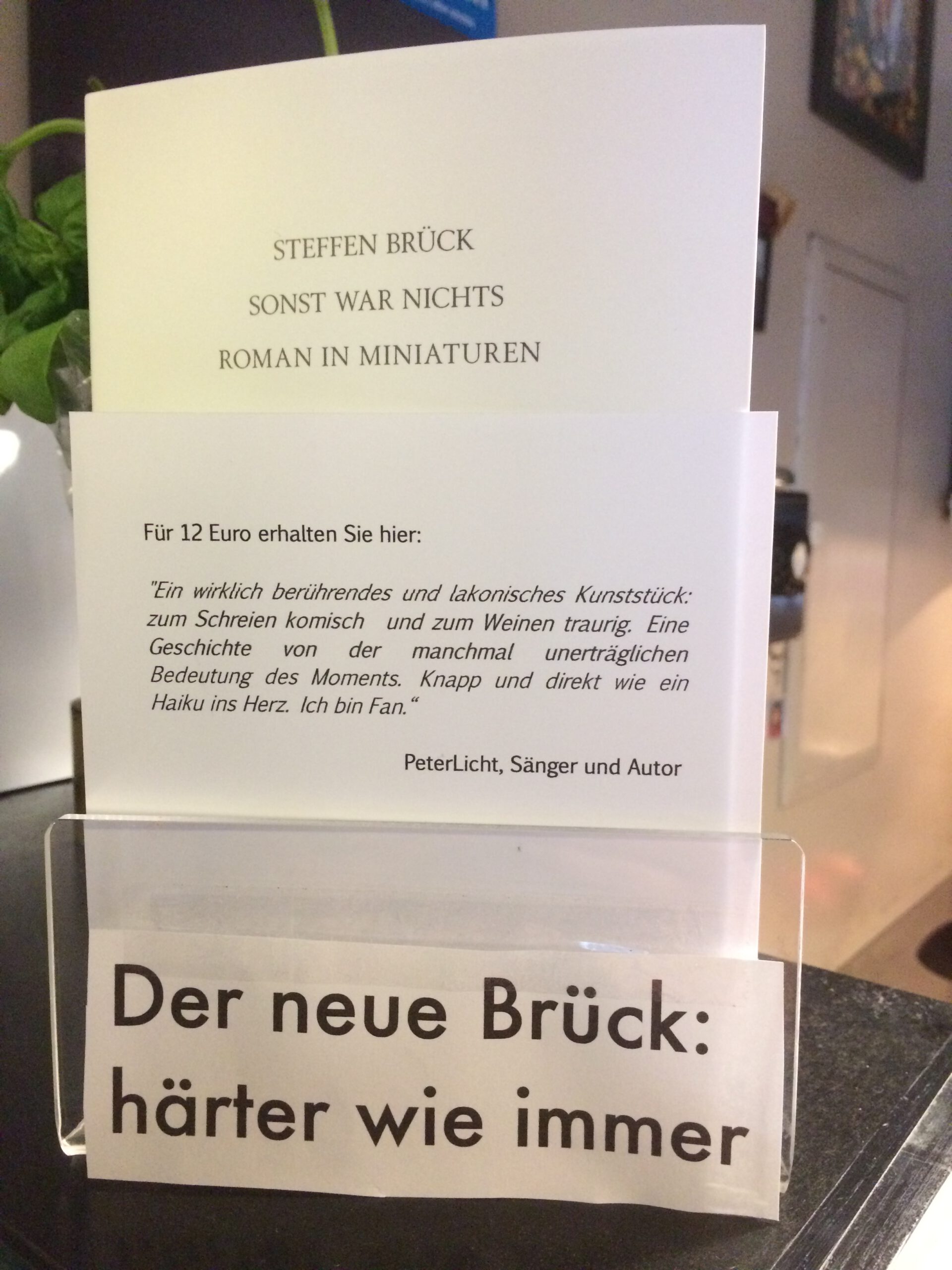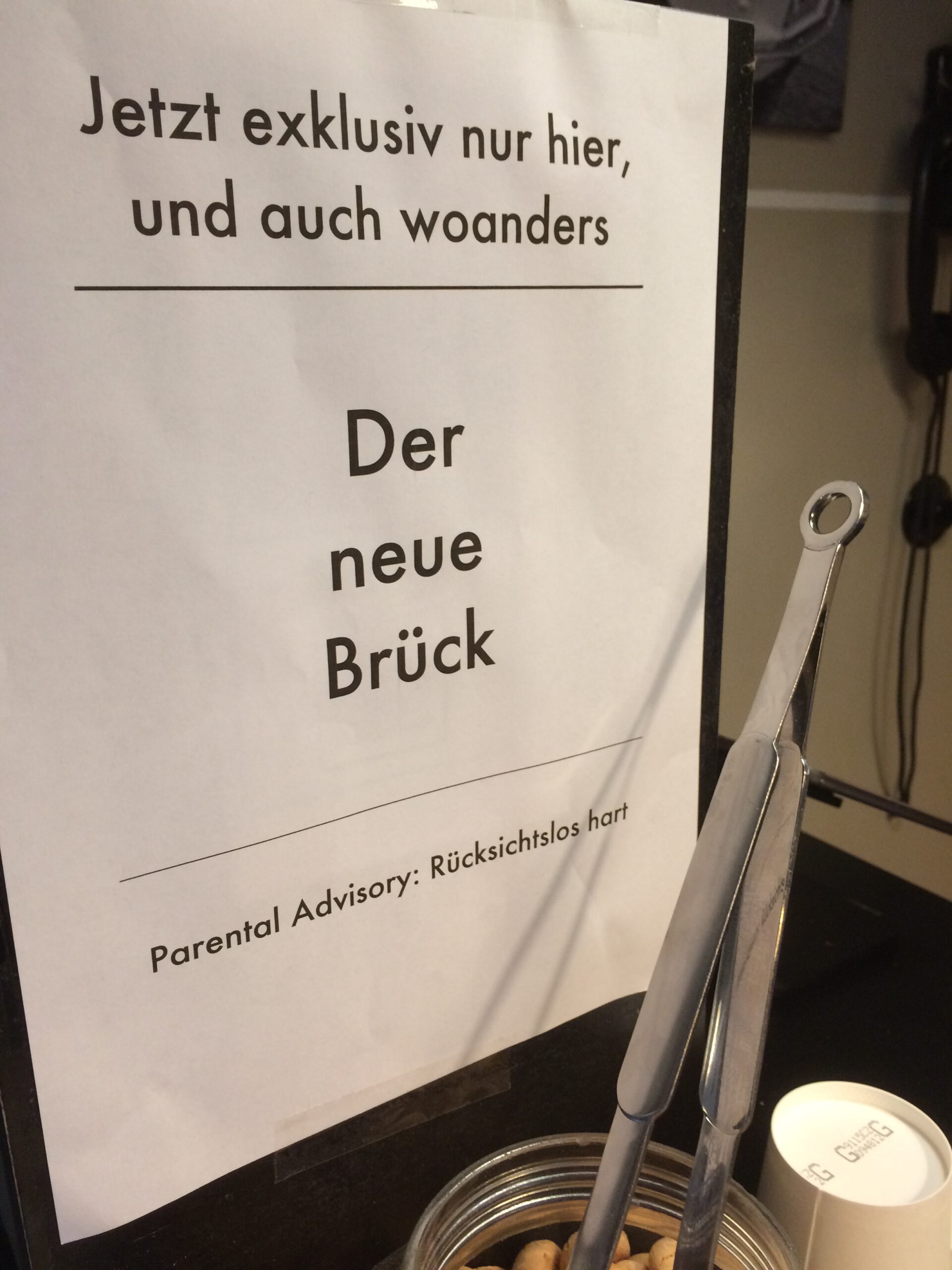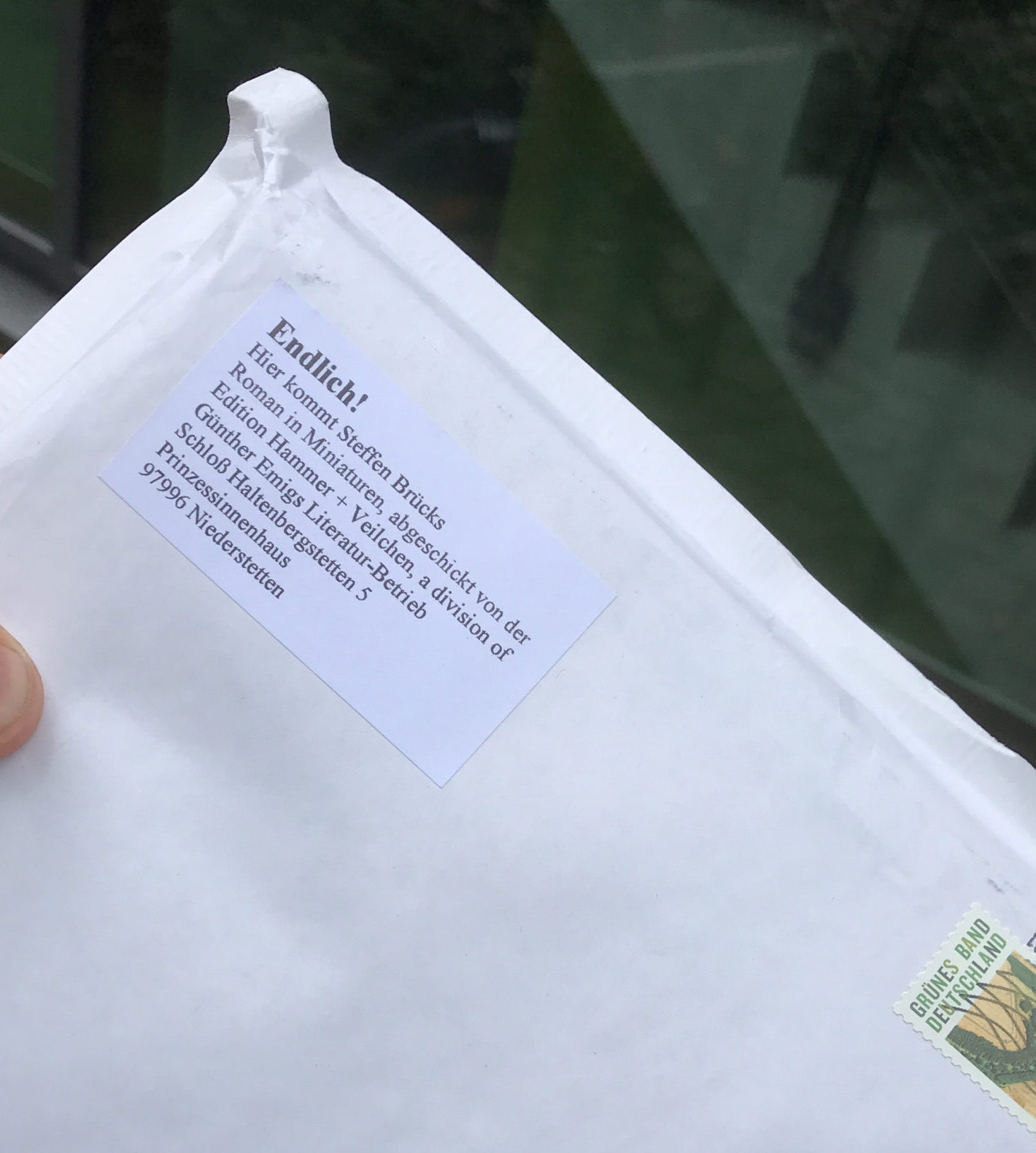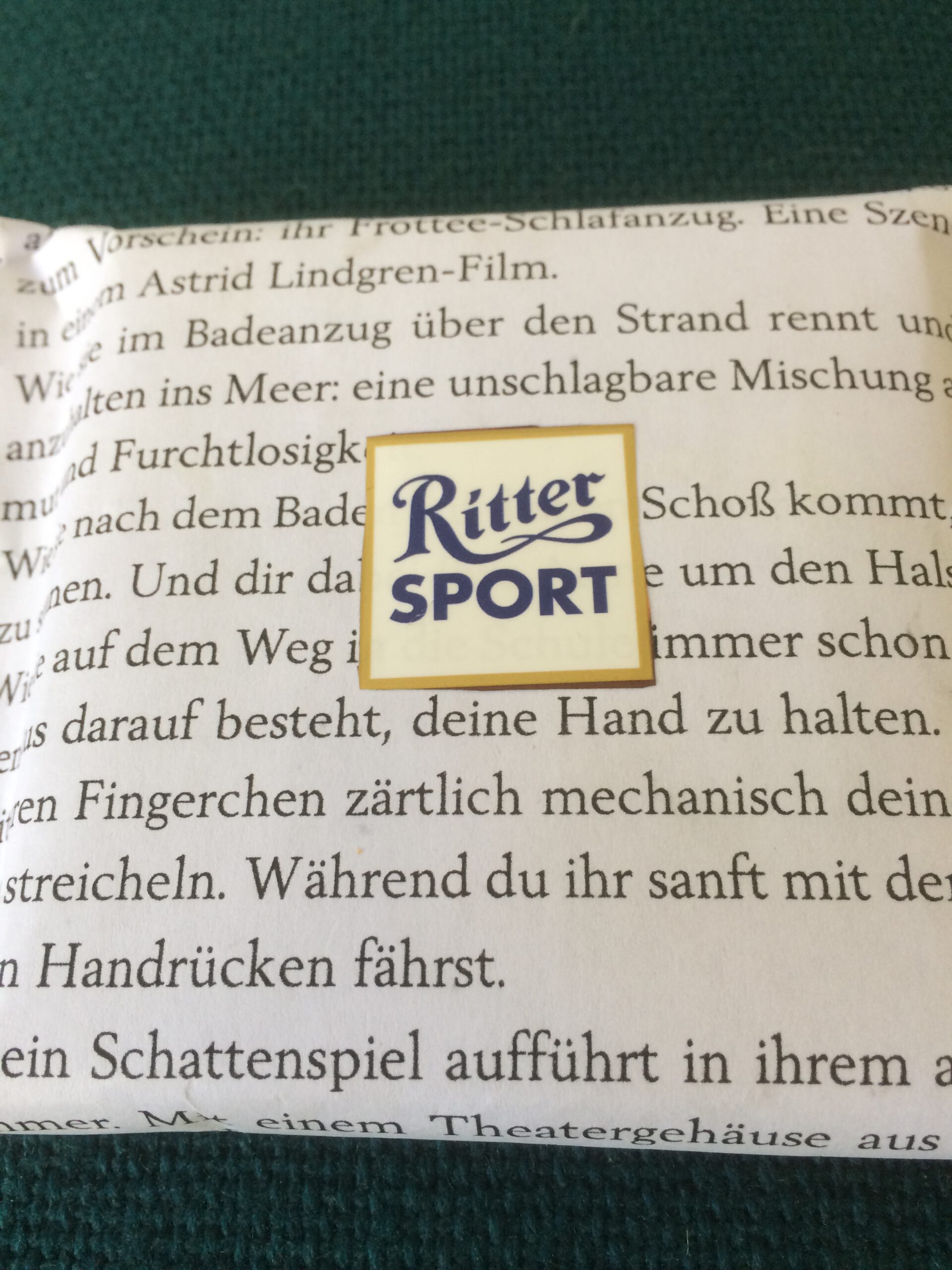Heute vor zwei Jahren starb Kurt Scheel. Sehr oft habe ich seither gedacht: Was würde Kurt Scheel dazu sagen? Oder: Schade, daß ich darüber nicht mit Kurt Scheel reden kann.
Ich habe weiter unten schon erzählt, daß wir gelegentlich gemeinsam ins Stadion gingen. Einmal sprachen wir dort vor Beginn des Spiels über den grausamen Prozeß des Alterns, des dann auch Altaussehens und Häßlichwerdens. Ein Thema, daß Kurt Scheel immer sehr beschäftigt hat. Jedenfalls gab er mir, dem genau 20 Jahre Jüngeren, an diesem Tag mit auf den Weg: „Das steht Ihnen auch noch bevor, Herr Brück.“

Der Hochmut der Jugend imprägnierte mich gegen derlei altersweise Hinweise und ich glaubte ihm deshalb natürlich kein Wort.

(Fotos: Igor Arslan)
Ein paar Wochen vor seinem Tod haben wir in Kreuzberg gemeinsam noch eine Lesung bestritten. Über diesen Abend hat Kurt Scheel einen Text geschrieben, der viel von dem aufweist, was ihn ausmachte: Geist, Witz, Albernheit, Bildung ohne Huberei. Hier ist er:
Lieber Siegfried,
als ich Dir sagte, ich müsste am Tag nach Siebenschläfer (da spielte die deutsche Mannschaft gegen Südkorea, den Tagesnamen fast zu wörtlich nehmend) zu einer LESUNG, lachtest Du, es war ein höhnisches, fast schon hämisches Lachen, und Du riefest aufgekratzt „Viel Spaß auch!“ und „Herzlichen Glückwunsch!“ und „Wohl bekommps!“, es war alles aber gelogen und blanker Sarkasmus, was ich flugs bemerkte, Du machtest ja auch kein Hehl aus Deiner beinahe schon kulturaversen Attitüde – durch Deine Ignoranz jedoch hast Du, ich sage es mit Trauer, mit „compassion“ (Willy Brandt), eine denkwürdige Lesung verpasst, wie es sie auch in diesem größeren Berlin so bald wohl kaum wieder geben wird.
Schon die Location war großartig, eine geradezu winzigkleine Bar mit dem Namen „Bar Italia“, also die blanke Wahrheit, denn es war unverkennbar eine Bar, und an den Wänden hingen Fotos von Sophia Loren, auf einem trägt ihr Carlo Ponti, ihr Eheherr, einen Sonnenschirm hinterher, da sieht man, dass er ungefähr halb so groß und doppelt so dick ist wie DIE Lorén, so sagte man in meiner Jugend, und ich erinnerte mich, dass ich, als ich von dieser Hochzeit damals erfuhr, Ende der fünfziger Jahre, sehr enttäuscht war von den Frauen AN SICH, denn Sophia, ein sog. Busenwunder, um das sich u. a. Cary Grant (!) beworben hatte, hatte nicht die Liebe und den unwiderstehlichen Mann gewählt, sehr guten, vielleicht sogar schmutzigen Sex und Remmidemmi, sondern soziale Sicherheit mit Spaghetti bolognese und Familienanschluss. Italiener! bzw. Frauen! mag ich damals gedacht haben, jedenfalls keimte in mir ein erster Verdacht, dass Frauen keineswegs so romantisch sind, wie sie es eigentlich sein sollten, sondern eher materialistisch und auf Sicherheit bedacht, und so sollte es dann ja auch kommen.
Jetzt aber füllte sich die Bar, es war ein heißer Sommerabend, außerdem der letzte Tag der Vorrundenspiele, hatten die Leute nichts Besseres zu tun, als zu einer „Lesung“ zu gehen? Offenbar nicht, denn die Massen strömten geradezu herein, bald waren es deutlich mehr als zwanzig, wenn auch weniger als dreißig, und der Eintrittspreis war nicht ohne (fünf Ocken), aber unter diesen Umständen war das Glas eben nicht halbleer, sondern dreiviertel voll, keineswegs „proppevoll“, wie der sympathische Wirt anmerkte, aber eben „voll“ (sans phrase). Etwa 80 Prozent Frauen, von vierzig bis siebzig, durch die Bank nett und hübsch und schlank, im Unterschied zu den Frauen auf dem Mehringdamm um die Ecke, die häufig halbbekleidet herumliefen, wodurch man überdeutlich sehen konnte, dass sie bei der Fleischverteilung quasi doppelt zugelangt hatten, und schräg gegenüber der braven und ehrlichen „Bar Italia“ glomm düster ein Friseurladen namens „Vorhair/Nachhair“, solch eine Gegend war das, touristisch verrohtes Kreuzberg sozusagen, cum Sprachspielhölle.
Es begann mit Musik, Elisabeth Tuchmann, eine professionelle Musikerin, spielte auf ihrer Gitarre, südamerikanischer Jazz, der aber wie Tango klang, also melodiös und schwermütig, sie sang auch sehr schön, das war schon einmal eine Überraschung, ich hatte mehr so atonales Gezirpe erwartet/befürchtet, aber das hier war keine pädagogische Lektion, sondern Wohlklang und Trost, und fast hätte ich den Takt mitgefüßelt. Dann las Herr Brück, der Veranstalter dieses Lesesalons, der regelmäßig stattfindet, aus neuesten Werken vor, recht schön, durchaus, eigentlich war es sogar SEHR gut, Gedichte, satirische Texte, auch poetisch-sarkastische Tagebucheinträge – freilich wurde dies alles dann gewissermaßen verdunkelt durch den Auftritt des Stargastes, eines auf den ersten Blick älteren, stattlich-überstattlichen Mannes, leider nur wenig Haare, beinahe Glatzkopf, und er schwitzte, dass Gott erbarm’. Doch als er zu lesen begann, mit zager und zitternder Stimme zuerst, rührten die zierlichen Worte und geistvollen Sätze, die tiefsinnigen Anspielungen und komischen Denkanstöße das Publikum so sehr und so schnell, dass es wie Zauber aussah, weiße Magie!
Drei Texte las der Stargast insgesamt, und nach jedem Vortrag war die Verbundenheit mit dem Publikum, vor allem dem weiblichen, tiefer, inbrünstiger noch. Mindestens drei, wahrscheinlich vier, vielleicht sogar fünf Damen dankten ihm danach persönlich für „diese sehr schönen Texte“ (so wörtlich!), zwei aber, und das war der finale Triumph, sagten, sie würden jetzt auch einmal, wie in den Texten beispielhaft vorgestellt, in den Stunden vor Sonnenaufgang durchs schlafende Berlin radeln. Damit war diesen Humoresken, wie der Stargast in der ihm eigenen Bescheidenheit seine „kleinen Stücke“ (Originalton) nannte, gelungen, was der große Rilke in seinem superweltberühmten Gedicht „Archaischer Torso Apollos“ als die zentrale Aufgabe aller Kunst benannt hat: „Du musst dein Leben ändern“, womit natürlich der Leser, nicht der Künstler gemeint ist! Was aber bei Rilke bloße Forderung, Wünschen und Wollen gewesen war, nun also hatte es sich vergegenständlicht, der Geist war Fleisch geworden bzw. wollte es werden, hatte es jedenfalls vor Zeugen versprochen! Das war ein Unterschied ums Ganze! Plötzlich erschien Rilke wie ein Vorläufer, siehe, es kommt aber nach mir ein Größerer, praktisch war der Duineser Elegiker eine Art Johannes der Täufer. Der aber nach ihm kam und Rilkes bloße Absichtserklärung umsetzen würde, das war, Du ahnst es plötzlich, wie Schuppen fällt es Dir von den Augen, der ominöse Stargast: olle Kurt himself, the one and only (moi)!
Ja, da muss ich selber lachen, wie lange ich Dich jetzt an der Nase herumgeführt habe! Und in gewisser Weise bist Du bei der Lesung sogar dabei gewesen, virtuell zumindest, Du marschiertest im Geiste, wie es in der dunkelste Stunde der deutschen Geschichte hieß, „mit“, indem ich nämlich drei „Briefe an Kohlhammer“ gelesen hatte, besonders schöne natürlich (den mit dem Fliedergedicht von Brockes, den Pfingstausflug cum Kuckuck, den mit dem Gedicht „Kleine Kinder“), und nicht wenige meiner (einfühlsamsten) Zuhörerinnen werden sicher gedacht haben, dass diese Humoresken sie irgendwie an Tschechow erinnern, an Robert Walser vielleicht auch, wenngleich sie jedoch in ganz eigner, unnachahmlicher Weise, mit einem wehen Lächeln, einem kecken Witz die Wahrheit sagen, oft indirekt, zwischen den Zeilen, aber doch so poetisch, so schön, man kann es kaum angemessen ausdrücken.
Und vielleicht wird es Dir einst gehen wie dem „Konzentrationslager-Erhardt“ in Lubitschs „Sein oder Nichtsein“, und man wird Dich fragen: „Sind Sie eigentlich der ‚Brief an Kohlhammer’-Kohlhammer aus diesen großartigen, ja genialen Prosagedichten (denn das sind sie, recht eigentlich besehen) von Kurt Scheel?“, und Du kannst dann wahrheitsgemäß antworten wie Joseph dem Pharao: Ich bin’s. Wenn Du willst, gebe ich Dir das auch schriftlich, meinetwegen notariell beglaubigt, mit solch einem Dokument kommst Du wahrscheinlich in jede Literaturlesung, kostenlos, vielleicht sogar ins Berghain!
Es ist schade, dass Du durch Dein hochmütiges, lesungsfeindliches Betragen diese Chance, bei einem Kulturevent ersten Ranges LIVE dabei zu sein, sogar mit Backstage-Pass, verspielt hast, kläglich, fast wie unsere Nationalmannschaft; von der „legendären Lesung in der Bar Italia“ hättest Du noch Deinen Enkeln bzw., Du hast ja keine Kinder, meinetwegen irgendwelchen fremden Enkeln erzählen können! Es sollte Dir jedenfalls eine Lehre sein, das wünscht Dir in alter, unverbrüchlicher Freundschaft
Dein Kurt