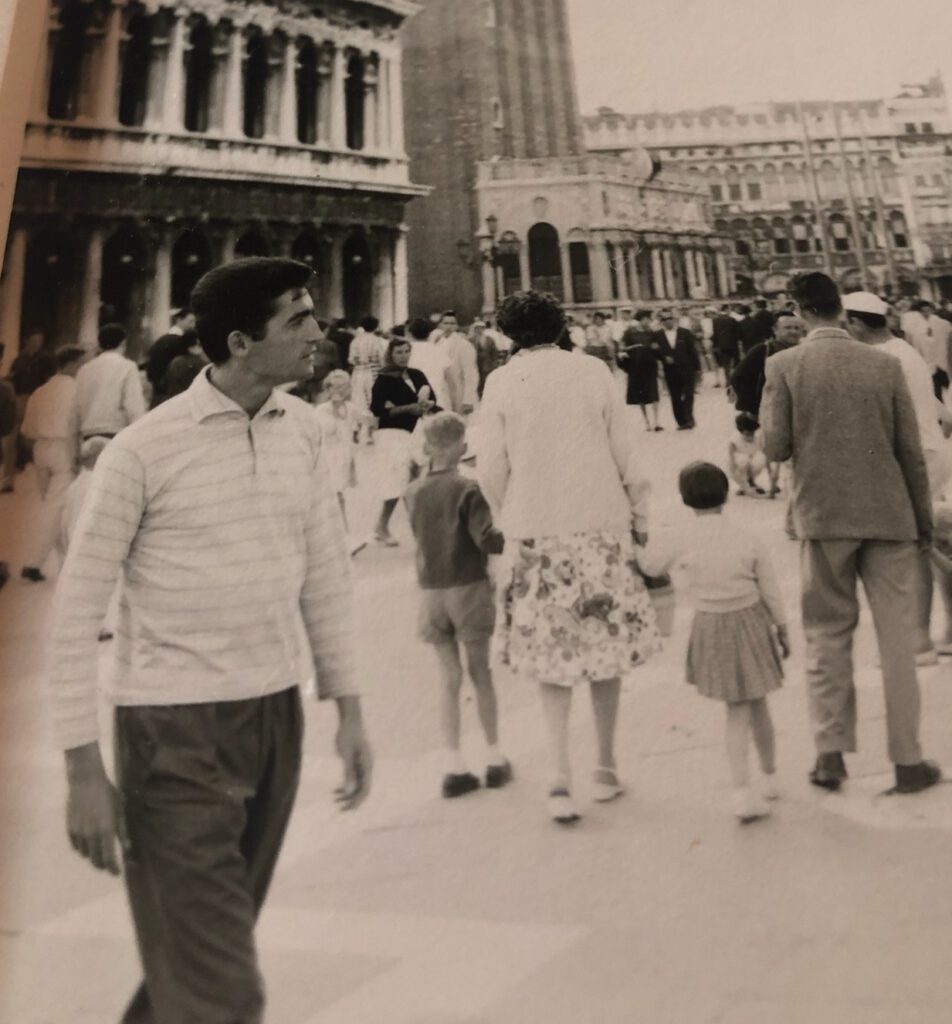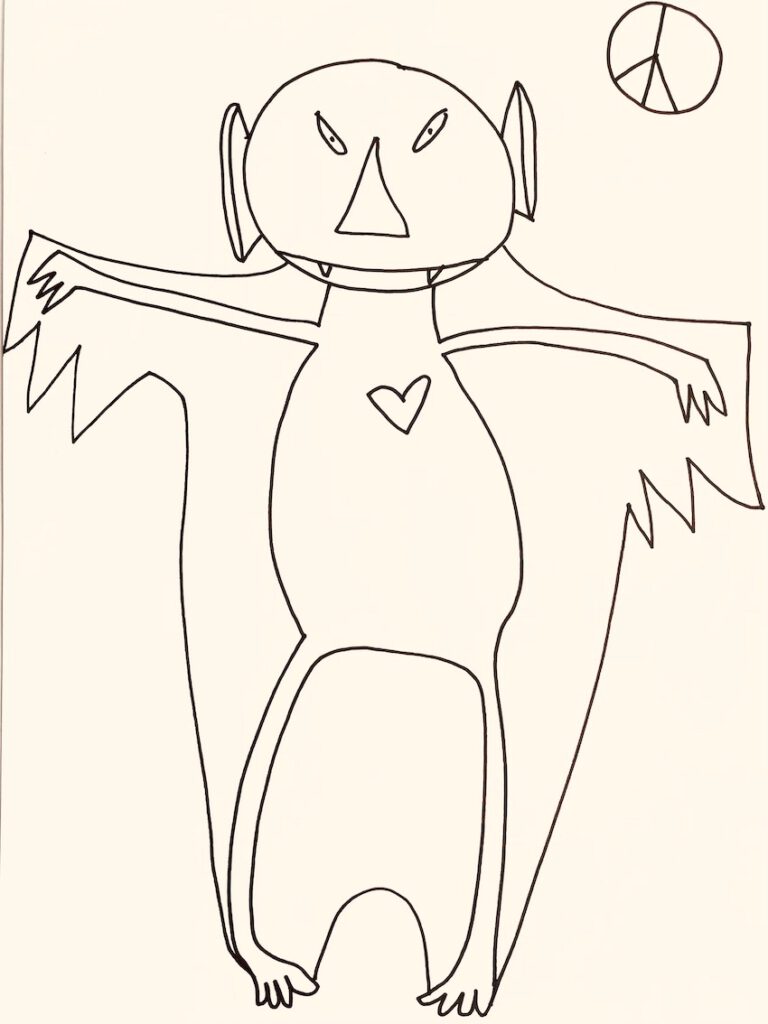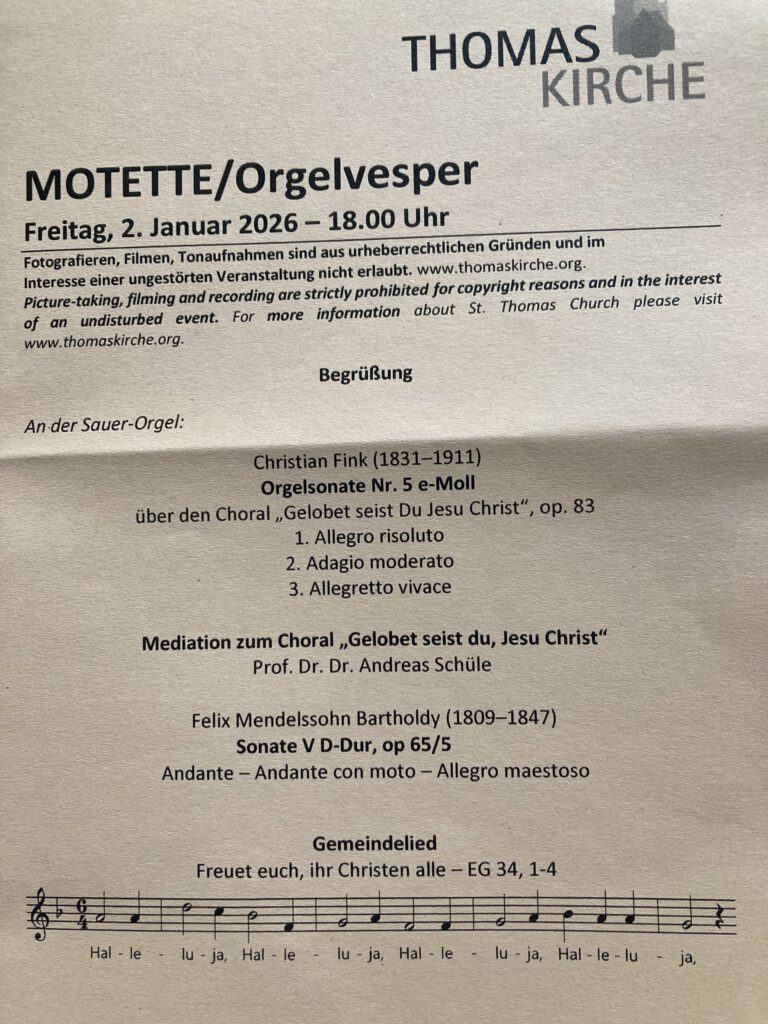Noch selten habe ich mich so arg auf ein Konzert gefreut wie auf das von Celeste am 17. Juni im Berliner Tempodrom.
Erstmals begegnet ist mir die Sängerin vor einigen Jahren als Duett-Partnerin von Paul Weller. Celeste beginnt sehr dezent, entweder Understatement, vielleicht auch Schüchternheit, holt dann aber plötzlich eine Stimme von man weiß nicht woher. Sehr schön auch die Momente des wechselseitigen grinsenden Erkennens:
Zwar sah ich schon das Unübersehbare, hörte schon das Unüberhörbare, verlor das Großtalent aber dennoch aus den Augen.
Bis mir Celeste vor einigen Monaten bei „Inas Nacht“ wiederbegegnete. Schaut Euch diesen Auftritt an und Ihr versteht sofort, warum Ina Müller währenddessen weinen mußte:
Nach dieser umwerfenden und herzschmelzenden Performance vertiefte ich mich in Celestes Werk, bislang zwei Alben, und erkannte sie:
als Sängerin, deren Ausdrucksvermögen sich, denke ich, messen kann mit dem großartiger Vorfahrinnen wie Nina Simone. Celeste singt keinen Ton, keine Phrase zweimal auf die gleiche Art. Sie kann stimmlich extrem viel, das Gefühl ist ihr aber immer wichtiger als die Virtuosität. Auch Kleidung, Styling, Gestik weisen sie aus als so stilbewusste wie eigene Künstlerin.
Und das Beste: Sie schreibt wundervolle Songs, die eingängig sind, obwohl sie immer wieder von den üblichen Mustern abweichen.
Bis Juni werde ich mich zwingen müssen, sie nicht übertrieben oft zu hören. Und ich bin mir eigentlich jetzt schon sicher, daß es Frau A. und mir dann ähnlich gehen wird wie im Jahr 2011, als wir die junge Adele im Kreuzberger „Huxley´s“ erleben durften: Uns werden spätestens beim zweiten gesungenen Ton die ersten Tränchen kullern.
Nehmt um der Dreifaltigkeit willen auch noch dieses dritte Video hier. Dann wißt ihr, warum ihre Eltern Celeste Epiphany Waite das Himmlisch-Göttliche namentlich mit auf den Weg gaben: