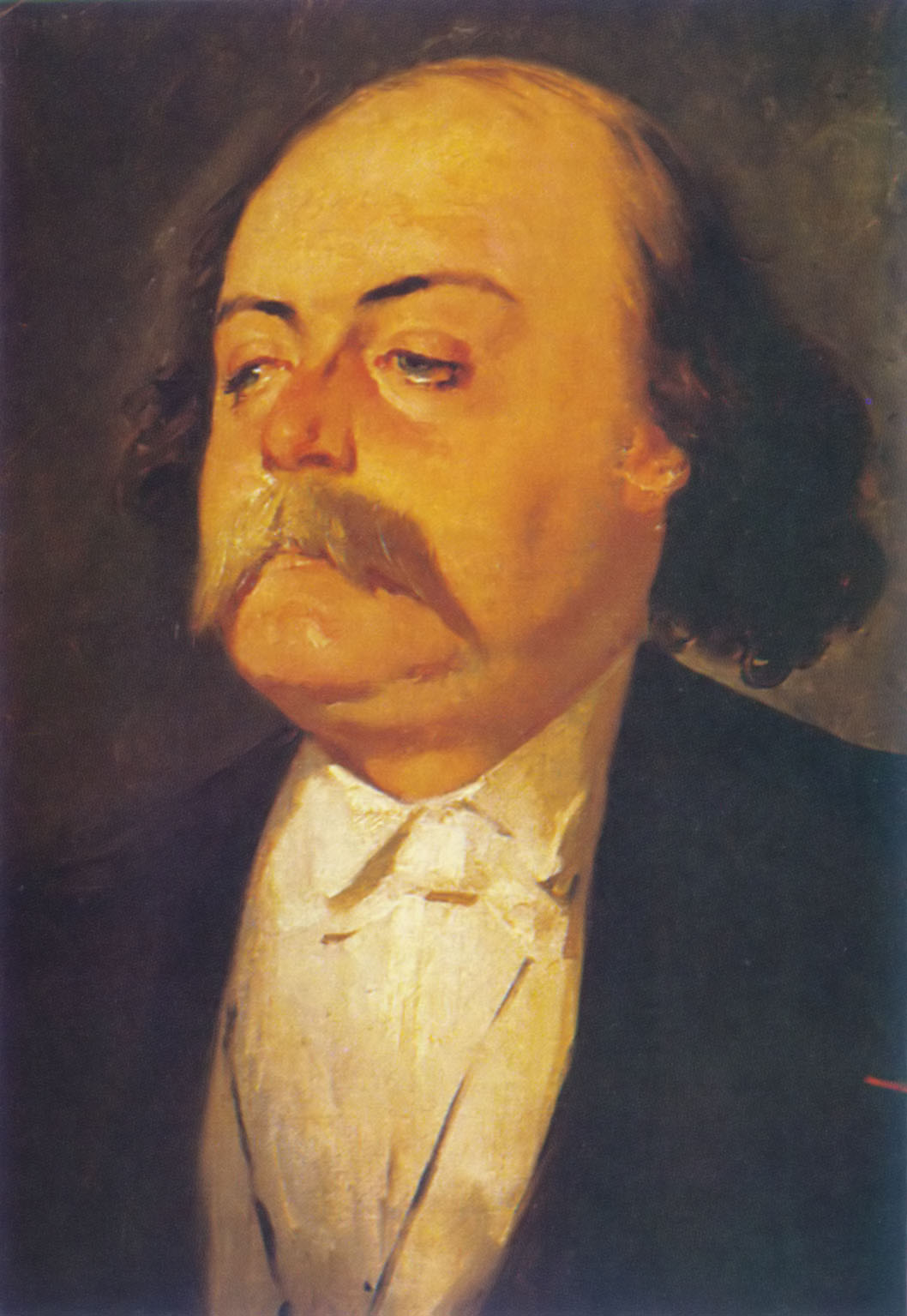Am dunkelsten Tag des Jahres möchte ich Euch daran erinnern, daß es wieder heller und auch im nächsten Jahr vermutlich einen Frühling geben wird. Man kann das manchmal gar nicht glauben.
„Du mußt an den Frühling glauben“ – der Titel meines Gedichts ist geklaut: von der Band „Jeremias“, die sich wiederum bei dem von ihr verehrten Jazzmusiker Bill Evans bedient hat: „You must believe in spring“. Klingt in beiden Sprachen toll.
Das noch ziemlich frische Gedicht als poetische Lebenshilfe und Ausblick aufs nächste Jahr, in dem möglicherweise sogar ein neuer Gedichtband auf die Welt kommen wird:
Du mußt an den Frühling glauben
Du mußt an den Frühling glauben,
glaub mir, weil er sonst nicht kommt.
Laß dir nicht den Glauben rauben.
Februar und März – und prompt
kommt der Frühling zwitschernd, singend,
pfeifend schwingst du dich aufs Rad,
raus mußt du und zwar sehr dringend,
inhalierst das Konzentrat:
Frühling, Lüfte, Düfte. Kühe
grüßen dich auch heute nicht.
Wäre viel zu viel der Mühe,
muhen nicht für ein Gedicht.
Du mußt an den Sommer glauben,
ja, ich weiß, ist manchmal schwer.
Laß dir nicht den Glauben rauben,
denn sonst kommt kein Sommer mehr.
Und schon ist das Freibad offen
und der Sprungturm auf.
Du mußt auf den Sommer hoffen
und den Sommerschlußverkauf.
Wind winkt durch den Weizen Wellen,
unter Bäumen steht ein Pferd,
krachend kaut es Mirabellen.
Ist das nicht bemerkenswert?
Auch den Herbst sollst du ersehnen,
denn du weißt, er tut dir gut,
darfst im Wald die Seele dehnen.
Macht das glücklich? Absolut.
Laub macht glücklich. Laub auf Haufen.
Laub in praktisch jeder Form.
Und auch durch das Laub zu laufen,
hebt die Laune echt enorm.
Mit Kastanien in der Tasche,
Erde an den Schuhn nach Haus,
öffnest eine grüne Flasche,
trinkst sie ohne Eile aus.
Langsam auf den Winter warten,
denn der läßt sich gerne Zeit,
schaust durchs Fenster in den Garten,
übst dich in Genügsamkeit.
Heizung bullert, wärmt das Zimmer,
draußen ist es naß und kahl.
Kaum ein Vogel und kein Schimmer.
It´s so hard to say: egal.
Laß dich nicht vom Winter stören.
Bis zum ersten Schmetterling
kannst du doch Bill Evans hören,
yes, you must believe in spring.
Du mußt an den Frühling glauben,
glaub mir, weil er sonst nicht kommt.
Laß dir nicht den Glauben rauben.
Februar und März – und prompt.
Und hier noch der Link zur gesprochenen Version des Gedichts: