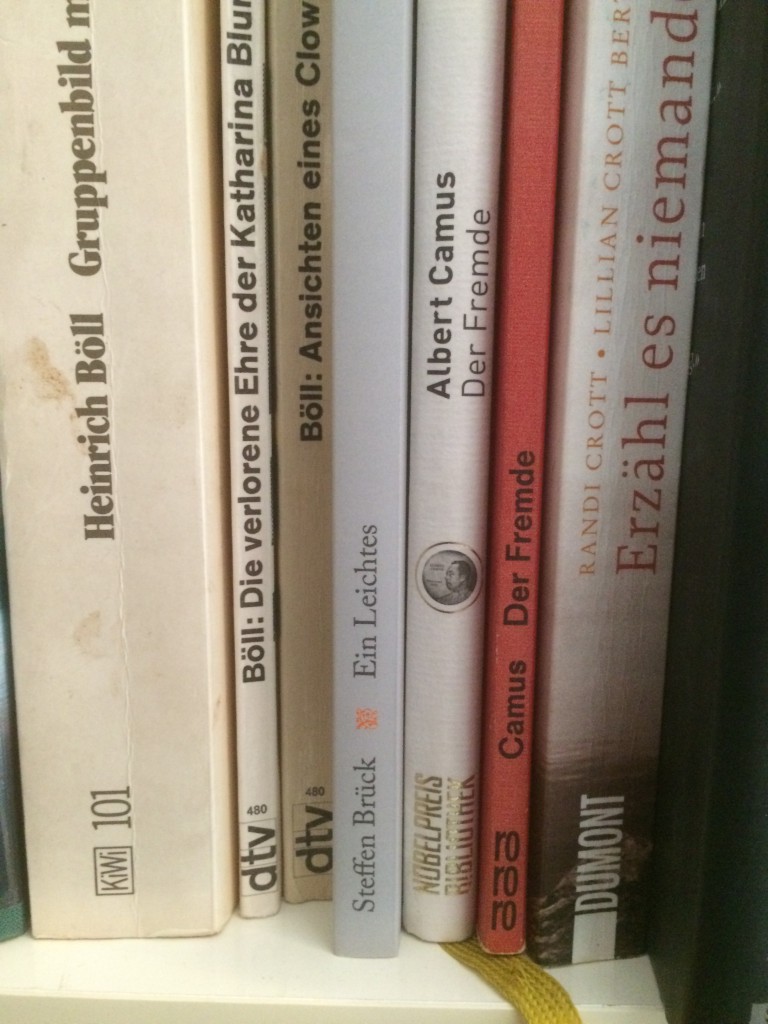Nicht daß ich mich sonderlich auskennte im Boxsport und im Leben Muhammad Alis. Daß aber dieser schöne und starke Mann auch ein Mann des gesprochenen Wortes und der Poesie war, ist mir dank des furiosen Dokumentarfilms „When We Were Kings“ aus dem Jahr 1996 nicht verborgen geblieben.
„Float like a butterfly, sting like a bee.
Your hands can’t hit what your eyes can’t see.“
Wer den eigenen Box-Stil so rhythmisch und bildmächtig und ohrwurmträchtig in Worte zu fassen vermag, läßt manchen hauptamtlichen Dichter samt seiner blutarmen Verse schon ein bißchen alt aussehen.
Gefreut habe ich mich auch über die im FAZ-Nachruf erwähnte Angewohnheit des jungen Ali, den Verlauf des bevorstehenden Kampfes in Reimform und möglichst präzise mit Rundenangaben vorherzusagen:
„This guy must be done/I´ll stop him in one.“
„Archie Moore/will be on the floor/in round four“
In die Annalen der Literaturgeschichte eingegangen ist Ali mit einem Auftritt vor Absolventen der Harvard-Universität im Jahr 1975. Ein Zuhörer bat ihn um ein Gedicht. Ali dachte kurz nach und sagte dann:
„Me. We.“
Dieses Poem gilt als das kürzeste der Weltliteratur und läßt viel Spielraum für Interpretation. (Es gibt auch die These, das Gedicht habe „Me? Whee!“ gelautet. Erscheint mir aber weniger plausibel.)
Ali hat sich gewünscht, als anständiger Mensch und großer Boxer in Erinnerung zu bleiben. Doch auch in den Gefilden der Poesie verfügte er über einen sehr respektablen Punch.
P.S. Für die lustvolle Ali-Exegese besonders gut geeignet ist nicht nur der oben erwähnte Film, sondern auch Jan Philip Reemtsmas kluges und weitgehend unverkopftes Buch „Mehr als ein Champion. Über den Stil des Boxers Muhammad Ali“.
P.P.S. Weiterbildung auch per Video möglich. Zum einen Billy Crystals furiose Rede inklusive liebevoller Imitation auf der Trauerfeier für Ali:
Trauerrede
Darin erwähnt Crystal auch sein Kurzdrama „15 Rounds“ aus dem Jahr 1979, in dem er Alis Boxer-Leben in zehn Minuten komisch und anrührend auf den Punkt bringt. Dabei Muhammad Ali schönerweise ständig als Zuschauer im Bild:
15 Rounds
P.P.P.S. Dem Buch „Rummel im Dschungel – Eine Reportage aus Kinshasa“ von Bill Cardoso entnehme ich nachträglich ein wichtiges Detail: Demnach hatte Ali in seinem langjährigen Betreuer Drew Bundini Brown eine Art Hausdichter und verbalen Sparrings-Partner. In dieser Funktion war Brown maßgeblich an der Entstehung von Kleinkunstwerken wie „Float like a butterfly“ beteiligt.